|
Independence Day -
Über das Schach und
die Rettung der Welt
"Wonnevoll ist's bei wogender
See, wenn der Sturm die Gewässer
Aufwühlt, ruhig vom Lande zu sehn, wie ein andrer
sich abmüht,
Nicht als ob es uns freute, wenn jemand Leiden erduldet,
Sondern aus Wonnegefühl, dass man selber vom
Leiden befreit ist.
Wonnig auch ist's ohn' eigne Gefahr die gewaltigen
Schlachten,
Die durch das Blachfeld toben im Kriege, mit Augen
zu schauen"
Lukrez (96–55 v.Chr.): Über die Natur
der Dinge.

|
|
Panik in
New York: 1996 oder 2001?
|
Die unbeschreiblichen Attentate des 11.
September ließen manches wieder erinnern, was
glücklicherweise vergessen schien. Zu den weniger
bedeutenderen Dingen darunter zählt auch Roland
Emmerichs peinlicher Film "Independence Day"
von 1996, der unverhältnismäßig oft
als Vergleich herhalten musste. Das ist insofern verständlich,
da die Unbeschreiblichkeit der Ereignisse nach Ausdruck
verlangt und angesichts der neuen qualitativen Dimension
man sich zwangsläufig dessen erinnert, was schon
mal irgendwie gesagt wurde, auch wenn man sich dabei
vollkommen in der Kategorie vergreift. Dabei ist der
Vergleich so dünn wie der künstlerische Gehalt
des recht bunten Streifens; er beschränkt sich
im wesentlichen auf die Bilder der zeitgleichen Zerstörung
New Yorks und Washingtons, symbolträchtig festgehalten
in den immensen Explosionen der Wolkenkratzer, die tatsächlich
den Kollaps der Twin Towers bildnerisch beeindruckend
antizipierten, und der Pulverisierung des Weißen
Hauses.
Erst heute allerdings wird vollends klar,
wie schlecht der Streifen ist, allein wenn man das Realitätskriterium
anlegt. Der Karlsruher Medienphilosoph Boris Groys glaubte
während dieses "Momentes der Evidenz"
sogar an die Signifikanz des Zitats: "wie sehr
die Terrorakte Filme wie ‚Independence Day‘
oder ‚Armageddon‘ zitierten" [1].
Sollte Osama Bin Laden also jemals geschnappt und seine
Schuld in diesem Zusammenhang nachgewiesen werden, so
wird er sich vielleicht auch des Plagiatsvorwurfes zu
erwehren haben und, neben Anklagen für diverse
Kapitalverbrechen, einem Urheberrechtsverfahren entgegensehen.
Für jemanden, der auf technische Mittel weitestgehend
verzichten soll, wie man hört, und der mit einem
System kooperiert, das Fernsehen und Radio sogar verbietet,
wäre das ein interessanter Fall von Horizontüberschreitung.
Nun, alle wissen es mittlerweile, die
Talibanregierung verbot auch das Schachspielen. Gerade
diesbezüglich scheint "Independence Day"
prophetische Gaben zu besitzen, denn das Schach spielt
hier eine wesentliche Rolle. Spitzt man den sich anbahnenden
Konflikt zu, so kann man sagen, dass nicht gewinnen
wird, wer den rechten Glauben vertritt, für oder
gegen die Demokratie eintritt oder wer über die
besseren militärischen Mittel verfügt, nein,
auch eine andere fundamentale Frage wird sich im "Kampf
der Kulturen" entscheiden: ob die schachspielende
oder schachnegierende Kultur siegreich sein wird, wobei
das Schach kein Akzidenz, sondern die Essenz ist. Anders
gesagt: wir befinden uns in einer gesteigerten und stark
abstrahierten Form des uralten Konfliktes, ob ein Krieg
sich nicht durch ein Schachspiel entscheiden lasse,
womit sich große Denker ernsthaft beschäftigt
haben, oder ob eine Gesellschaft, die das Schachspiel
verbietet, nicht schon deshalb zum Scheitern verurteilt
ist, und zwar, weil sie sich dadurch, so der Verdacht,
durch eben dieses Verbot, entscheidender Ressourcen
beraubt oder aber sich im Gegenteil durch die Konzentration
auf das Wesentliche (Gott) und das Verbot der Ablenkung
davon, neue Ressourcen schafft. Dies zumindest ist der
Konflikt, den man aus der Gegenüberstellung der
Botschaft des einst vielbejubelten Filmes "ID 4"
und den Realereignissen am Hindukusch filtrieren kann.

|
|
Der Denker
... seitenverkehrt
|
Gleich zu Beginn des Streifens, als die
Welt noch in Ordnung schien und nur die Spitze der Militärs
und Politiker das Undenkbare zu ahnen beginnen, dass
Vertreter einer außerterrestrischen Zivilisation
sich dem Planeten nähern und leider ganz und gar
nicht den Text der Astronautentafel auf dem Mond, der
von "Peace for all" spricht, zu verstehen
gewillt sind, gleich zu Beginn sitzen David Levington
und sein Vater Julius friedlich in einem New Yorker
Park – vielleicht sogar zu Füßen des
World Trade Centers [2]
– und spielen Schach.
Schon mag das Interesse des Schachenthusiasten
geweckt sein, auch wenn die ausgetragene Partie zum
Filmgeschehen wenig Substantielles beizutragen weiß,
die Szene hingegen schon. Sie dient als Mittel, die
beiden Protagonisten der Handlung in schnellen Zügen
vorzustellen. Ruhig, gelassen und konzentriert sitzt
der Junior da, gänzlich vom Vater unterschieden,
der nervös eine Zigarre raucht, dabei ununterbrochen
redet und den Sohn zum zügigen Ziehen überreden
will. Man sieht, wie David den Bauern auf e3 fasst,
um ihn nach kurzem Zögern wieder an seinen Platz
zu stellen. Worüber er nachdenkt, ist eine Falle,
ist ein Zug, der objektiv weniger stark ist, gegen einen
schwächeren Gegner allerdings einen raschen Sieg
versprechen könnte. Der Vater drängt, witzelt,
der Sohn antwortet nur mit dem richtungsweisenden Satz:
"I'm thinking", "Ich denke"
und ist damit ausreichend charakterisiert, sein Sein
ist so eins in der Szene, dass er als falschverstandenes
Zitat von Descartes "cogito ergo sum"
zu gelten hat. Tatsächlich wird er die Rolle des
Denkers übernehmen, dessen geniale Einfälle
letztlich die Welt retten werden. Doch wie weit ist
es her mit seinen denkerischen Fähigkeiten? Schach
sollte nie Indikator für diese Bewertung sein,
da es nur einen sehr limitierten Denkbegriff enthält,
aber da es gemeinhin noch immer als allgemeines Denkspiel
missverstanden wird, kann es auch im Film entsprechend
instrumentalisiert werden. David zieht schließlich
doch den Bauern nach e4, ein kleiner, unauffälliger
Zug, so wollen uns die Bilder sagen, der große
Wirkung zeitigt. Zwar weiß der Vater unversehens
zu reagieren, aber, wie sich herausstellen wird, ungenügend:
....e5 kann sein Problem nicht lösen. Wieder denkt
David. Und nicht nur über das Schach, nein, er
findet zudem Zeit, seinen Erzeuger auf die lange Dekompositionszeit
des Plastikbechers hinzuweisen, aus welchem der Alte
sich einen Kaffee gönnt. David ist ökologisch
bewusst; später wird er auch seine Arbeitskollegen
darauf hinweisen, dass Coca-Cola-Dosen in den Recyceleimer
gehören!! Merkt Euch das ein für alle mal,
denn die Welt muss nicht nur gegen Aliens verteidigt
werden, nein, auch gegen böse Menschen, die noch
immer ihre Dosen unbedacht im Hausmüll entsorgen.
Schließlich findet David den Schlüsselzug
– Dame nach g5 -, den sein Gegner nur mit einem
"Aha" kommentiert. Sofort fährt der Erfahrenere
ihm in die Parade, triumphierend schaut er dem Sohn
ins Gesicht, in seinen Brillengläsern spiegelt
sich das Schachbrett. Wieder wird dialogisiert, man
erfährt über Davids geschiedene Ehe und über
die gesundheitsschädliche Wirkung des Rauchens
– ein Großteil der Situationskomik wird sich
aus dieser Belehrung ergeben – und wieder die Unruhe
des Vaters: "Come on, move on. This is not healthy."
und er meint sowohl das Spiel als auch Davids Leben,
das sich bewegen soll. Dann Großeinblendung Schachbrett:
Dame schlägt Bauer g6 und die magischen Worte –
sie werden zum Leitfaden des Films: "Checkmate"
– "Wait a minute, wait a minute, wait a minute...
this is not checkmate, this is not checkmate..."
Verdammt, doch! David steigt auf sein Rad – was
sonst? – den Vater ärgert die Niederlage,
Ende der Szene. Schauen wir uns die Partie im entscheidenden
Stadium noch einmal in Ruhe an.

Die Ausgangsstellung. David (Weiß)
hat schon eine ganze Figur eingebüßt, wenn
Schwarz solide weiterspielt sollte nichts mehr schief
gehen können. Andererseits bietet die seltsam offene
h-Linie vielleicht noch Schummelchancen.
1.e4 Die Idee ist klar: Weiß
will die Dame in den Angriff am Königsflügel
einschalten, aber die Idee ist ebenso falsch, denn zuvor
hätte der Zug mit Th4 vorbereitet werden müssen.
Spielbar wäre auch noch Tg3 mit Druck auf g6 gewesen.
(Auf den ersten flüchtigen Blick sieht 1.Dxd6?
verlockend aus, doch der Abzug 1...Lxg2+!! 2.Kxg2 Dxd6
entscheidet die Partie. Gut gesehen, David! Man darf
nicht auf die faulen Tricks der anderen hereinfallen.)
1...e5? Ein ernsthafter Fehler.
(Mit 1...Sg4 – deckt h6 und zielt auf den neuralgischen
Punkt f2 - hätte Schwarz seinen Vorteil sicher
behauptet. 2.Sd1 scheint nun fast schon erzwungen, gibt
allerdings den Bauern preis: 2...Lxe4 3.Th4 Lf5 und
Schwarz steht fest wie ein Fels.)
2.Dg5?? Der Gewinnzug! Das wäre
nur in der wirklichen Welt ein Widerspruch, in Hollywood
hingegen ist alles möglich: Präsidenten fliegen
Düsenjets gegen Aliens, Menschen lieben sich im
Angesicht von Millionen Toten, Computerviren werden
durch Körperkontakt übertragen und Verlustzüge
führen zum Gewinn. Was soll daran so seltsam sein?
(2. Dh6!+ hätte dagegen nur sehr langfristig gewonnen,
was im Skript wohl nicht vorgesehen war. 2...Kf7 [2....Kg8?
man muss mit allem rechnen vgl. gespielte Partie 3.
Dxg6#] 3.Tf1 fesselt den Springer, der wiederum h6 überdeckt;
mit dem Ziel Thh3 und massivem Druck auf f6.)
2...Kg8!! Ein Hollywood Zug unter
Zeitdruck, denn Zeit ist Geld im big business.
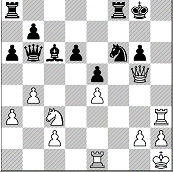
Die Stellung in der entscheidenden
Phase: Soeben hat Vater Levington den unglaublichen
Zug Kg8!! gefunden.
3.Dxg6!!# Eiskalt! (3. Dh6!? hätte
die Partie noch offen gehalten - just for fun! 3...Kf7
4.Tf3 mit Vorteil Weiß)
Fazit: Emmerichs Versuch, uns Intelligenz
als schachkompatible Größe zu verkaufen,
muss bei genauer Analyse als gescheitert gelten. Davids
spielerische Fähigkeiten lassen im Kampf gegen
die Außerirdischen an sich nichts Gutes ahnen.
Eine fachmännische Beratung hätte dem Film
wenigstens zu einer glaubhaften Szene verholfen.
Die offenbare Unkenntnis der Materie
hinderte jedoch nicht daran, das Schachspiel auf allerhöchster
Ebene weiter zu benutzen. Die zweite signifikante Szene
spielt sich eine halbe Stunde später im Büro
des Medienunternehmens ab, in welchem David arbeitet.
Die Belegschaft ist geflohen, schon schwebt das kilometergroße
feindliche Objekt bedrohlich über den Häuptern.
Da plötzlich kommt dem jungen Schachmeister die
Idee: die Aliens nutzen unsere eigenen Satelliten, mehr
noch, ihr Vorhaben lässt sich damit berechnen.
Geht die Rechnung auf, dann erwartet die Menschheit
in nicht allzu langer Zeit die Katastrophe. "It‘s
like in chess", erklärt er seinem schwulen
hysterischen Freund. "Zuerst bringst du deine
Figuren in strategische Positionen. Dann, wenn die Zeit
heran ist, schlägst du zu." Die Fernsehbilder
scheinen seine Theorie zu bestätigen: Über
allen wichtigen Hauptstädten der Welt haben die
galaktischen Bösewichter Stellung bezogen, sie
nehmen strategische Positionen ein. In nur noch sechs
Stunden, so die Rechnung - genügend Zeit, um noch
nach Washington zu rasen, den Präsident und die
Ehefrau zu retten -, werden sie losschlagen: "And
then what?" – langer, sorgenvoller, intensiver
Blick, und wieder das Zauberwort, von dem Borges einmal
sagte, es dürfe im Rahmen des Spiels nicht gesagt
werden [3], denn es beendet
alles: "Checkmate!!" – "Oh my
god, oh my god, oh my god!", begreift der Freund
in einer herzzerreißenden Szene. Noch nie dürfte
das "Schachmatt" eine solche emotionale Eskalation
hervorgerufen haben.
 Doch
schon hier ahnt der Zuschauer, dass es eine Lösung
geben wird, vertrauensvoll schaut er in die bebrillten
und klugen Augen Davids, des Denkers. In diesem genialen
und verantwortungsbewussten Kopf muss sich die Lösung
finden lassen und paart man dies noch mit einem heldenhaften
Präsidenten, der seine Soldatennatur höchst
selbst im Kampfjet ausleben wird - ein kleiner Seitenhieb
auf den ungedienten Clinton -, addiert man dazu noch
den Mut des supercoolen amerikanischen Marines, geschauspielert
von Will Smith, und vergisst man schließlich nicht
die militärisch-ökonomisch-wissenschaftliche
Macht Old Sams hinzuzurechnen, dann wird auch dem fassungslosesten
Kinobesucher klar: du kommst hier lebend raus, alles
wird gut, die Freiheit siegt. Die Botschaft ist so alt
wie der amerikanische Film, neu hingegen ist die Schlüsselrolle
des Schachs dabei. Es dient hier als große Matrix,
als grundlegendes Regelwerk, dessen selbst die hyperintelligenten
Schleimbestien aus dem All mächtig sind, wenn auch
offensichtlich auf inferiorer Stufe, es erlangt letztlich
kosmologische Dimension. Einstein mag Recht haben: Gott
würfelt nicht, aber mit Sicherheit spielt er Schach!
Wie einst Bobby Fischer, so nimmt auch David im selbstauferlegten
Auftrag der Menschheit den Schachkampf mit Gott auf,
vorausgesetzt, er spielt mit Weiß und das ist
die weiße Weste, das saubere Gewissen, die gute
Tat. Der Anzugsvorteil ergibt sich aus der indiskutablen
Übermoral, die nur böse Zungen als Anthropozentrik
diskreditieren. So wird dem Schicksal noch ein Schnippchen
geschlagen und das scheinbar unausweichliche "Checkmate",
das im Bauch des Leviathan zum dritten Male als negatives
Fanal und Zauberwort ausgesprochen wird, wandelt sich
zur Siegesformel. - "What do you think?",
tiefes Nachdenken, Schweigen, dann: "Checkmate."
Ruhe. Zigarren werden gezückt. Trompetenklang:
Die Helden machen die und liegen in den letzten Züge(n)
- David und der besagte Fighter Capt. Steven Hiller,
der nach anfänglichen Startschwierigkeiten selbst
ein Aliengefährt zu fliegen weiß, befinden
sich da schon im grusligen Inneren des Bösen, in
jenem bienenstockähnlichen, ameisenhaufenartigen,
termitenhügelhaften monströsen Gebilde, in
dessen Zentrum die hässliche, riesenhafte, stöhnende
Mutter- und Königinnengestalt thront. Deren Schaltzentrale
bildet die Welt fast schachbrettartig ab, das kleine
vom Gegner besetzte Raumschiff, stellt nur eine unter
vielen winzigen Figuren dar, einem Bauern im Schach
vergleichbar, den man unauffällig von e3 nach e4
zieht, die tödliche Falle zu stellen. Der Glaubwürdigkeit
des Films hätte es unbedingt gut getan, wenn dies
wenigstens mit einem Menschenopfer verbunden gewesen
wäre, aber nein, es gelingt den vergifteten Bauern,
die den Virus brachten, selbst noch die Flucht, kurz
bevor alles kollabiert. Das Selbstmatt des Vaters wiederholt
sich auf höherer, viel höherer, auf apokalyptischer
Stufe im Selbstmatt der außerterrestrischen Mutter.
Alles ist nur ein Spiel, wollen uns diese Bilder sagen,
man muss nur die Regeln kennen, auch ein bisschen tapfer
sein, die Freiheit lieben und all das Gelaber... und
du gewinnst. Ach so, man sollte am besten auch noch
Amerikaner sein. So werden aussichtslose Lagen "gehandled". Doch
schon hier ahnt der Zuschauer, dass es eine Lösung
geben wird, vertrauensvoll schaut er in die bebrillten
und klugen Augen Davids, des Denkers. In diesem genialen
und verantwortungsbewussten Kopf muss sich die Lösung
finden lassen und paart man dies noch mit einem heldenhaften
Präsidenten, der seine Soldatennatur höchst
selbst im Kampfjet ausleben wird - ein kleiner Seitenhieb
auf den ungedienten Clinton -, addiert man dazu noch
den Mut des supercoolen amerikanischen Marines, geschauspielert
von Will Smith, und vergisst man schließlich nicht
die militärisch-ökonomisch-wissenschaftliche
Macht Old Sams hinzuzurechnen, dann wird auch dem fassungslosesten
Kinobesucher klar: du kommst hier lebend raus, alles
wird gut, die Freiheit siegt. Die Botschaft ist so alt
wie der amerikanische Film, neu hingegen ist die Schlüsselrolle
des Schachs dabei. Es dient hier als große Matrix,
als grundlegendes Regelwerk, dessen selbst die hyperintelligenten
Schleimbestien aus dem All mächtig sind, wenn auch
offensichtlich auf inferiorer Stufe, es erlangt letztlich
kosmologische Dimension. Einstein mag Recht haben: Gott
würfelt nicht, aber mit Sicherheit spielt er Schach!
Wie einst Bobby Fischer, so nimmt auch David im selbstauferlegten
Auftrag der Menschheit den Schachkampf mit Gott auf,
vorausgesetzt, er spielt mit Weiß und das ist
die weiße Weste, das saubere Gewissen, die gute
Tat. Der Anzugsvorteil ergibt sich aus der indiskutablen
Übermoral, die nur böse Zungen als Anthropozentrik
diskreditieren. So wird dem Schicksal noch ein Schnippchen
geschlagen und das scheinbar unausweichliche "Checkmate",
das im Bauch des Leviathan zum dritten Male als negatives
Fanal und Zauberwort ausgesprochen wird, wandelt sich
zur Siegesformel. - "What do you think?",
tiefes Nachdenken, Schweigen, dann: "Checkmate."
Ruhe. Zigarren werden gezückt. Trompetenklang:
Die Helden machen die und liegen in den letzten Züge(n)
- David und der besagte Fighter Capt. Steven Hiller,
der nach anfänglichen Startschwierigkeiten selbst
ein Aliengefährt zu fliegen weiß, befinden
sich da schon im grusligen Inneren des Bösen, in
jenem bienenstockähnlichen, ameisenhaufenartigen,
termitenhügelhaften monströsen Gebilde, in
dessen Zentrum die hässliche, riesenhafte, stöhnende
Mutter- und Königinnengestalt thront. Deren Schaltzentrale
bildet die Welt fast schachbrettartig ab, das kleine
vom Gegner besetzte Raumschiff, stellt nur eine unter
vielen winzigen Figuren dar, einem Bauern im Schach
vergleichbar, den man unauffällig von e3 nach e4
zieht, die tödliche Falle zu stellen. Der Glaubwürdigkeit
des Films hätte es unbedingt gut getan, wenn dies
wenigstens mit einem Menschenopfer verbunden gewesen
wäre, aber nein, es gelingt den vergifteten Bauern,
die den Virus brachten, selbst noch die Flucht, kurz
bevor alles kollabiert. Das Selbstmatt des Vaters wiederholt
sich auf höherer, viel höherer, auf apokalyptischer
Stufe im Selbstmatt der außerterrestrischen Mutter.
Alles ist nur ein Spiel, wollen uns diese Bilder sagen,
man muss nur die Regeln kennen, auch ein bisschen tapfer
sein, die Freiheit lieben und all das Gelaber... und
du gewinnst. Ach so, man sollte am besten auch noch
Amerikaner sein. So werden aussichtslose Lagen "gehandled".
Man darf den Fakt, dass ein Schachspieler
die Welt rettet, nicht unterbewerten, noch dazu, wenn
man selber einer ist und vor allem nicht vor dem Hintergrund
der aktuellen Ereignisse. Dass "wir die Welt
zum Sieg führen werden", sind Worte beider
US Präsidenten: Thomas J. Whitmore und George W.
Bush. Die Einteilung in Schwarz und Weiß ist so
alt wie das Genre, es lebt regelrecht von derartigen
Primitivismen. Aber es ist andererseits das Schachspiel
selbst, mit seiner ständischen Symbolik, das sich
immer wieder für diese Urvergleiche hergeben muss.
Hat sich je ein Schachspieler über diese maßlose
Kompetenzüberschreitung beschwert? Im Gegenteil:
genüsslich sammeln die Gazetten Entgrenzungsbeispiele
in der irrigen Hoffnung, das Spiel damit aufzuwerten.
Wer die Regeln im großen Schach des Überlebenskampfes
nicht kennt oder gar gegen sie verstößt,
die Regeln, die wir selbst dem Spiel verleihen, gehört
ausradiert. Schlicht und einfach. Ist dies einmal anerkannt
oder gedankenlos akzeptiert, dann kann man sich Reflexionen
über die Relation von Subjekt und Objekt ersparen,
anders gesagt: das Recht ist immer auf der Seite des
siegreichen Subjekts.
 Nur,
so einfach wie im Film können wir es uns nicht
machen, hier muss eine Moraldiskussion wenigstens angedeutet
werden, gesetzt, dass sich im modernen Katastrophenfilm
eine gesellschaftspsychische und -psychiatrische Verfassung
entäußert. Andernfalls könnten sie weder
produziert noch goutiert werden. Mit welchem tatsächlichen
Recht spielen wir die Vernichtung, die "extermination"
– so der mehrfach benutzte Terminus - fremder Lebensformen
durch? Steckt dahinter das juristische Argument der
Selbstverteidigung oder das vulgärdarwinistische
von der "Krone der Schöpfung"? "Wenn
man Unkraut vertilgt oder Ungeziefer ausrottet",
schrieb der Radikalökologe Rudolf Bahro, "sagt
man exterminate... Es meint die massenhafte Vernichtung
von Leben, das wir für unwert befunden haben." [4]
Zumindest die Wortwahl also ist im Film nicht zufällig,
aber sie zeigt auch, wie weit entfernt sie von der Intention
jedes ernstzunehmenden Schachspielers ist. Man muss
die feindlichen Fremdlinge als Ungeziefer, als Insekten
darstellen, um einer Moraldiskussion aus dem Wege zu
gehen, es sind gigantische, hyperintelligente Insekten,
aber eben noch immer Insekten, Gribbel- und Glibberzeug,
und damit der menschlichen Rasse unterlegen, auch wenn
sie ihr intellektuell tatsächlich Lichtjahre voraus
sind. Spätestens seitdem wir virtuell derartige
Szenarien durchspielen, dies wird im Ansatz klar, sind
klassisch belegte Begriffe wie "Humanismus"
und "Menschenrecht" diskussionswürdig. Nur,
so einfach wie im Film können wir es uns nicht
machen, hier muss eine Moraldiskussion wenigstens angedeutet
werden, gesetzt, dass sich im modernen Katastrophenfilm
eine gesellschaftspsychische und -psychiatrische Verfassung
entäußert. Andernfalls könnten sie weder
produziert noch goutiert werden. Mit welchem tatsächlichen
Recht spielen wir die Vernichtung, die "extermination"
– so der mehrfach benutzte Terminus - fremder Lebensformen
durch? Steckt dahinter das juristische Argument der
Selbstverteidigung oder das vulgärdarwinistische
von der "Krone der Schöpfung"? "Wenn
man Unkraut vertilgt oder Ungeziefer ausrottet",
schrieb der Radikalökologe Rudolf Bahro, "sagt
man exterminate... Es meint die massenhafte Vernichtung
von Leben, das wir für unwert befunden haben." [4]
Zumindest die Wortwahl also ist im Film nicht zufällig,
aber sie zeigt auch, wie weit entfernt sie von der Intention
jedes ernstzunehmenden Schachspielers ist. Man muss
die feindlichen Fremdlinge als Ungeziefer, als Insekten
darstellen, um einer Moraldiskussion aus dem Wege zu
gehen, es sind gigantische, hyperintelligente Insekten,
aber eben noch immer Insekten, Gribbel- und Glibberzeug,
und damit der menschlichen Rasse unterlegen, auch wenn
sie ihr intellektuell tatsächlich Lichtjahre voraus
sind. Spätestens seitdem wir virtuell derartige
Szenarien durchspielen, dies wird im Ansatz klar, sind
klassisch belegte Begriffe wie "Humanismus"
und "Menschenrecht" diskussionswürdig.
--- Jörg Seidel, 07.11.2001 ---
[1]
vgl. Die tageszeitung (TAZ), 17.10.2001
[2] vgl. Rochade Europa
10/2001, S. 95
[3] Jorge Luis Borges: Fiktionen.
Frankfurt/Main. 1994. Seite 87
[4] Rudolf Bahro: Logik
der Rettung. Wer kann die Apokalypse aufhalten? Ein
Versuch über die Grundlagen ökologischer Politik.
Berlin 1990. Seite 27
Dieser Text ist geistiges Eigentum von
Jörg Seidel und darf ohne seine schriftliche Zustimmung
in keiner Form vervielfältigt oder weiter verwendet
werden. Der Autor behält sich alle Rechte vor.
Bitte beachten Sie dazu auch unseren Haftungsausschluss.
|
|

