|
Gustav Schenk: Das
leidenschaftliche Spiel.
Schachbriefe an eine Freundin
Man muß Gustav Schenks kurzen Briefroman
"Das leidenschaftliche Spiel" wohl zu den
vergessenen Schachbüchern zählen. Das verwundert
in mehrfacher Hinsicht. Immerhin ist das Büchlein
in verhältnismäßig hoher Auflage erschienen
– mir liegt die erste Auflage vor, "Erstes
bis Fünftes Tausend"; ob es eine zweite gab,
entzieht sich meiner Kenntnis –, und wurde zudem
unter dem Titel "The Passionate Game" ins
Englische übertragen. Von seiner relativ weiten
Verbreitung zeugt auch das regelmäßige Auftauchen
bei Ebay, oft ein
guter Indikator für die Popularität eines
Werkes.
Schenk (1905-1969), sowenig man von ihm
erfahren kann, schien eine interessante und vielseitig
interessierte Person gewesen zu sein. Kein geringerer
als Ernst Jünger korrespondierte mit dem Drogenexperten
[1] und empfing einige Besuche
Schenks während des Kriegsherbstes 1944 in Kirchhorst,
wo man, von Fliegeralarm und Bombengedröhn umgeben,
von Katastrophe und Tod, "über die berauschende
Kaktee Payotl" spricht, "sodann über
ein dreißigtägiges Fasten, zu dem er Vorbereitungen
trifft" oder: "Sodann mit Schenk im Atelier
von Grethe Jürgens" – einer bekannten
Malerin der Neuen Sachlichkeit [2],
die übrigens die acht Farbtafeln im vorliegenden
Buch beisteuerte – "dort Unterhaltung über
die Pflanzen der Moore und Halligen" [3].
Fast mag es enttäuschen, keine Erwähnung eines
gemeinsamen Schachspiels vorzufinden; immerhin teilte
Jünger, dem nur wenige Tage später der verstorbene
Vater beim Schachspiel im Traum erscheint, die Passion
für das - nun warum nicht -, für das leidenschaftliche
Spiel.
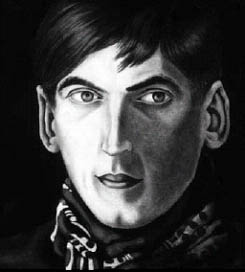
Grethe Jürgens:
Bildnis Gustav Schenk. 1931. Öl auf Leinwand
(Bildquelle: http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2001/0394/pdf/abbmbil-sw.pdf)
Vor allem aber verblüfft die heutige
Resonanzlosigkeit, weil Schenks "Schachbriefe an
eine Freundin" zu den besseren, zu den wohlüberlegteren
und tieferen Erklärungsversuchen zum Rätsel
Schach zählen. In keinem der gängigen Referenzwerke
findet es Erwähnung oder eine substantielle Besprechung
(und auch beim Googeln findet sich nichts). Dabei bedient
sich der Autor einer seit der Klassik und Romantik stets
wohlbewährten Form – man denke an den "Werther",
an Bettina von Arnims "Günderode", an
"Die gefährlichen Liebschaften": den
Briefroman. Erst 1934, zwei Jahre vor Schenks Werk,
feierte der philosophische Briefroman in Gestalt der
"Philosophie des Alltags. Briefe eines Philosophen
an ein junges Mädchen", verfaßt von
Franz Carl Endres, bemerkenswerte Verkaufserfolge. Möglicherweise
verdankt Schenk diesem Buch entscheidende Anregung;
vergleichende Analysen würden eine ganze Reihe
von Übereinstimmungen aufweisen.
Vordergründig will das kleine Buch
zweierlei sein: Geschichte einer verkannten Liebe und
Anleitung zur Erlernung des Schachspiels. Unter diesen
Gesichtspunkten ist es für uns weniger ergiebig,
auch wenn die Rahmenhandlung den ästhetischen Genuß
garantiert, auch wenn die Spieleinführung weniger
direkt und technisch sich darbietet als in den Hunderten
bekannten Erstlingswerken. Wirklich mitteilenswert wird
es als – in Anlehnung an Endres’ Untertitel
– "Briefe eines Schachphilosophen…".
Der Ich-Erzähler bekennt: "ich will Ihnen
ein Spiel zeigen und philosophiere" (31). Erst
am Ende lernen wir, daß die Motive nicht ganz
so selbstlos wie vorgegeben waren, daß jenes "Zauberspiel"
durchaus doppeldeutig, vieldeutig zu verstehen ist,
als Schach- und Liebesspiel. Mit den Tücken des
Schachs soll die an einen anderen verlorene Geliebte
zurückerobert werden, eine Rahmenhandlung, die
ob ihrer unerwarteten Wendungen zu überzeugen vermag.
An der Oberfläche freilich will der Verführer
"nur" in jenes Zauberspiel, "dieses größte
Spiel der Menschheit" einführen, "das
aber Ihre Sinne schärft, ihren Gefühlen eine
Atempause gewährt, das eisig und frostig ist oder
warm und glühend, ganz wie Sie es wünschen
und leiten, und das Sie ohne sichtbare Mühe den
Kampf lehrt, Kampf als Lebensgefühl, Kampf als
Grund aller Bewegung" (9). "Kampf", so
lautet denn auch das Zauberwort, an dessen hartem Klang
der Schreiber sich nicht satt hören kann. Auch
dieses Wort klingt in seinem Munde vieldeutig: im Spiel,
um die Geliebte, vor allem Kampf als Universalerklärung
aller Entwicklung – abgeleitete aus dem Schachspiel.
Das klingt zu deutlich nach Lasker (oder dem frühen
Jünger), um an einen Zufall glauben zu können
(vgl. auch S.35).
Erfüllt ist der Briefschreiber von
heiliger Ehrfurcht, die ihn zu fast absurden Überhöhungen
verleitet: "…daß das Schachspiel allein
den Glauben an die wunderbaren Kräfte des Menschen
stärken kann" (8). Es kann auch nicht erfunden
worden sein, nein, man muß es entdeckt haben,
schließlich ist es "ein Teil der Natur",
nicht anders als der Mensch selbst und unterliegt den
quasi-darwinschen Gesetzmäßigkeiten: "Sie
stehen nicht außerhalb, Sie sind ihren Gesetzen
unterworfen, Sie brauchen nur elementar zu reagieren,
Sie müssen nur kämpfen mit allen Mitteln Ihres
Instinkts, um gut Schach zu spielen" (10). Gut
bedeutet ganz offensichtlich nicht erfolgreich. Erst
nachdem die Ehrfurcht im Gegenüber erweckt wurde,
macht sich der Schreiber an die Regelkunde, beginnt
die Figuren, die Züge zu erläutern. Das ist
naturgemäß trockene Materie und kann nur
gelegentlich durch mystizistische Einfügungen verklärt
werden. Etwa wenn er im Springer "ausschweifende
Phantasie, Härte, Zartheit, Macht und Zauber des
Schachs beschlossen" sieht oder in der Dame das
"Symbol Ihres Geschlechtes überhaupt. Sie
ist nicht die bestimmte mit Namen zu nennende Dame,
sie ist Prinzip einer Naturmacht" (24).
Auf den nächsten Dutzend Seiten
gibt Schenk ein erstes Spielbeispiel und wählt
dafür das altbekannte Seekadettenmatt:
- e4 e5
- Sf3 d6
- Lc4 h6?
- Sc3 Lg4?
- Sxe5! Lxd1
- Lxf7 Ke7
- Sd5+#
Schwarz vernachlässigt seine Figurenentwicklung
und erleidet demzufolge – das ist die uralte Lehre
aus dieser Miniatur – eine satte Niederlage.
Nebenbei erläutert er Rochade, en-passant-Regel
etc. und auch da muß er mit geheimnisvollem Geraune
seine junge Partnerin bei der Stange halten. "Wir
haben es wirklich so weit gebracht, daß wir meinen,
ein Spiel sei eine milde Art von Betäubungsmittel,
das man im schläfrigen, halbwachen Zustand ohne
die geringste innere Beteiligung anwenden dürfte,
hemmungslos, ohne Verantwortung, zum Amüsement,
um die Seuche der Langeweile vergessen zu machen. Doch
das Schach ist kein Spiel unserer Zeit. Es entstammt
alten, reichen Kulturen, die die Zivilisationskrankheit
Langeweile nicht kannten und die ein Kampfspiel mit
dem gleichen Einsatz der Kräfte, mit der gleichen
Anspannung einer für alles gerüsteten Seele
ausübten, wie einen ernsthaften Kriegshandel, der
über Tod und Leben entschied" (31). Ganz gleich,
ob das stimmt, es ist trotzdem wahr! "Sie wissen
es – ich will Ihnen den Sinn des Schachspiels deutlich
machen. Es soll Ihnen ein jetzt noch fremdes, erregendes
Gefühl zurückbleiben, das sie nie wieder loswerden
können, solange Sie ein Schachbrett sehen: es ist
die ernste, fast tragische Erkenntnis von der unerbittlichen
Konsequenz einer Handlung, die weit über ein Spiel,
wie wir es aufzufassen gewohnt sind, hinausgeht"
(48).

Bereits aus solchen Äußerungen
wird deutlich, wie wenig seine Spielauffassung mit dem
wissenschaftlich betriebenen Schach, dem professionell
betriebenen Schach gemein hat. Insbesondere das Erforschen
von Eröffnungen, von ungezählten Varianten
und Untervarianten kann den Beifall des beseelten Spielers
nicht finden, der gerade das Irrationale, das Unvorhergesehene,
die Phantasie aller eisernen Logik und Rechenkunst vorzieht.
"Was kam dabei heraus? Trocken gebackene Remisspiele,
krampfhaft gehaltene, von der Forschung erzwungene Gleichgewichtslagen,
Annäherungen an das Gleichgewicht, das es im Schach"
– und nun folgt die vielleicht tiefste Stelle des
Buches – "das es im Schach ja nicht gibt"
(51). Mit diesem bemerkenswerten Satz widerspricht Schenk
aller bisherigen und zukünftigen Schachtheorie
seit Steinitz. "Das Schach ist ein Kampfspiel,
in ihm gibt es keinen Ausgleich und keine Gleichgewichtslage"
(16). Offensichtlich kann der minimale Anzugsvorteil
hier nicht gemeint sein, nein, besagtes Ungleichgewicht
stammt aus anderer Quelle. Der Versuch durch systematische
Forschung ein Gleichgewicht herzustellen entspricht
einem auf Nivellierung ausgerichteten Geist des Zeitalters.
Tiefer jedoch ist das Pantha Rei, das sich im dauerhaften
Kampf der Gegensätze manifestiert. Es ist das Gesetz
schlechthin, "das in der menschlichen Natur ebensogut
herrscht, wie im Kristall oder im Aufbau der Welt"
(52). Und wo das Gleichgewicht doch entsteht, dort muß
man es bewußt stören, z.B. durch ein Opfer,
durch ein Gambit! Hier ist es das Evans-Gambit. Je fragwürdiger,
desto reizender. Natürlich darf dann nicht der
halbe Punkt das Ziel der Partie sein, sondern das Erlebnis
desselben. "…mein Ehrgeiz geht nur dahin,
die Atmosphäre eines atemberaubenden Spieles wiederzugeben"
(56).
Exkurs
Wie tief das Vorurteil einigen Gambits
(z.B. Evans-Gambit, Blackmar-Diemer-Gambit, Albins Gegengambit)
gegenüber im Gedächtnis der professionellen
Spieler verankert ist, zeigt eine Bemerkung Peter Heine
Nielsens (NIC 8/2003. S. 47ff.), der soeben ein Evans-Gambit,
eine denkwürdige Partie, gegen Nigel Short knapp,
äußerst knapp, überstand. Schon nach
4. b4!! kann er sich nicht verkneifen, anzumerken: "Here
again, I’m not too impressed with the Englishman’s
sense of time. This was popular around 1860." Danach
entwickelt sich ein rasantes Spiel, in dem Heine Nielsen
ununterbrochen zu verteidigen hatte und Short leider
im entscheidenden Moment den Gewinnzug nicht fand.
Nigel Short - Peter Heine Nielsen
[C52]
Skanderborg 2003,
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4
exd4 7.Qb3 Qe7 8.0-0 Bb6 9.cxd4 Nxd4 10.Nxd4 Bxd4 11.Nc3
Nf6 12.Nb5 d5 13.exd5 Bxa1 14.Ba3 Qe5 15.f4 Bd4+ 16.Kh1
Qe3 17.Nxd4 Qxb3 18.Re1+ Kd8 19.Be7+ Kd7 20.Nxb3 c6
21.d6 b6 22.Bxf7 c5 23.Nd2 Kc6 24.Nc4 Bf5 25.Ne5+ Kb7
[25...Kb5? 26.Re3 h5 (26...Ka5 27.Rg3±) 27.Bc4+
Ka4 28.Rg3±] 26.a4? [26.Re3! b5 27.Rg3 Be4 28.Rxg7
Nd5 29.f5 c4 30.Bxd5+ Bxd5 31.d7+-] 26...h5 27.Bxf6
gxf6 28.Bd5+ Ka6 29.Bc4+ Kb7 30.Bd5+ Ka6 31.Bc4+ Kb7
½-½
Der dänische Großmeister läßt
sich anschließend zu jener aufschlußreichen
(und originellen) Äußerung hinreißen,
die so tief in das (fehlende) Abenteuerverständnis
des Profischachs blicken läßt: "After
the game my opponent said he wondered why the Evans
is so little played at top level. I think it’s
because it loses a pawn".
Schließlich wird auch das Endspiel
besprochen. Im Elementarsten, etwa einem einfachen Bauernendspiel,
sieht der Verfasser den "Sinn des Schachs offenbar"
werden, denn dort, "wo die Fülle der Figuren
nicht mehr verwirrt", wird "das Gerüst
des Schachs deutlich" und "im Gerüst
die organische Einheit des Spiels" (64). Mit derart
weisen Worten endet der technisch orientierte Vortrag
an die Geliebte. Im Abschiedsbrief sinniert der Schachphilosoph
über Wert und Sinn des Spiels. "Ich wollte
Sie sammeln und nicht zerstreuen, ich wollte Ihnen nicht
Selbstvergessenheit schenken, sondern Sie zum Kampf
rüsten" (65). Schach ist eben mehr als Zeitvertreib
und Belustigung, auch wenn der individuelle Spieler
das darin finden mag. Allein schon das historische Phänomen
stellt uns, die jetzigen Schachspieler, in eine lange
Tradition und die wiederum stellt die inhärente
Frage: Was spricht das Schach im Menschen an, da es
jahrtausendelang und in vielen verschiedensten Kulturen
wirkmächtig war und ist? [4]
Es ist das immer Aktuelle: "Der Inhalt des Schachspiels
wird unser Inhalt sein, der Kampf wird unserem
Kampfsinn entsprechen", ihr "praktischer Sinn"
ist es, zu "helfen, wahrhaftig zu spielen"
(67f.). Hätte das Wort "wahrhaftig" nicht
auch kursiv gesetzt sein müssen? Wahrhaftigkeit
und historische Bedeutsamkeit lassen sich in einem Wort
bündeln, ein Wort, welches dem modernen Menschen
sauer aufstoßen muß. Aber aus diesem Wort
bezieht das Schach seine Subversivität. Es lautet,
in seinen verschiedenen Schattierungen: Überflüssigkeit,
Sinnlosigkeit, Folgenlosigkeit oder eben auch: Verschwendung.
"Bedeutsam ist nur die großartige Verschwendung
von Kraft und Phantasie, die hier in Erscheinung tritt.
Zeit und schöpferisches Handeln sind scheinbar
ohne Nutzen vergeudet worden für ein – Spiel.
… Es ist aber immer ein Merkmal höchster Kultur
gewesen, verschwenden zu können, ohne nach dem
Nutzen zu fragen. Mit dem Schach werden keine äußeren,
keine sichtbaren Vorteile erlangt. Es ist aus einem
anderen Lebensbedürfnis entstanden, aus einem Übermaß
an Kraft" (69).
Gustav Schenk: Das leidenschaftliche
Spiel. Schachbriefe an eine Freundin. Schünemann
Verlag Bremen 1936, 92 Seiten, Mit 8 mehrfarbigen Bildtafeln
von Grethe Jürgens
--- Jörg Seidel, 07.03.2005 ---
[1]
Von ihm stammt u.a. der Klassiker: Das Buch der Gifte.
[2] http://www.fembio.org/frauen-aus/hannover/grethe-juergens.shtml
[3] Ernst Jünger: Sämtliche
Werke. Erste Abteilung. Band 3. Tagebücher III.
S. 306 und 312
[4] vgl. Metapsychik
des Schachs
Dieser Text ist geistiges Eigentum von
Jörg Seidel und darf ohne seine schriftliche Zustimmung
in keiner Form vervielfältigt oder weiter verwendet
werden. Der Autor behält sich alle Rechte vor.
Bitte beachten Sie dazu auch unseren Haftungsausschluss.
|
|

